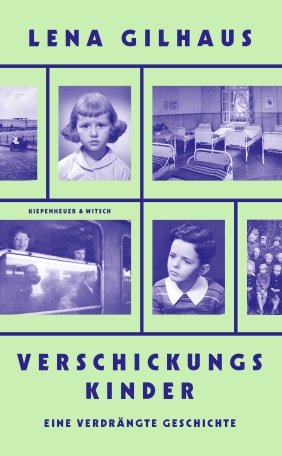Die Organisation
Die Durchführung der Kuren oblag den Bundesländern. Die Heime unterstanden den Landesjugendämtern, Kreisjugendämtern oder städtischen Jugendämtern in enger Kooperation mit den jeweiligen Gesundheitsämtern (S. 15). Das ist wichtig, wenn man Akten über das eigene Heim finden möchte. Vor allem die unteren Ämter mauerten gerne oder gaben falsche Auskünfte. Viele Archive befinden sich bei den Landeswohlfahrtsverbänden. Viele Jugendämter nahmen ihre Aufsichtspflichten nicht wahr und machten sich damit zu Komplizen.
Transporte
Es wurde berichtet, wie man Sonderzüge zusammenstellte. Die Transporte mussten kostengünstig sein (S. 48ff.). Teilweise waren die Züge überbelegt und bis zu 17 Stunden mit viel zu wenig Betreuungspersonal unterwegs. Auch die Bundesbahn verdiente gut an den Verschickungen. Mindestens zwei Kinder kamen bei diesen „Transporten“ wegen mangelhafter Aufsicht ums Leben (S. 58). Niemand wurde bestraft. Eine alleinerziehende arme Mutter erhielt 1.000 DM als Entschädigung für ihr totes Kind.
Ankunft und Schäden
Nach dem Schock von Trennung und Transport kam die Ankunft in den Heimen als Dauerschrecken. Die Kinder erlebten einen unfreundlichen Empfang und den Zwang, an Gewicht zuzunehmen. In vielen Heimen mussten die Kinder das Erbrochene aufessen. Im Kinderheim Waldhaus der Diakonie in Bad Salzdetfurth erstickt der siebenjährige „Stefan“ an seinem Erbrochenem. Im selben Jahr kam es noch zu zwei weiteren Todesfällen (S. 75f.).
Das Tagesprogramm: Die Heime verfügten über zu wenig Geld und hatten kaum Mittel, um mehr und besser geschultes Personal einzustellen. Deshalb griff man auf NS-Gesundheitshelferinnen zurück. Viele kritische Hinweise stammen von sozialpädagogischen Praktikantinnen der jüngeren Generation. Doch diese wurden nicht ernst genommen.
Gewalt und Tod
Es mehren sich die Berichte von gewalttätigen älteren Jungen aus Erziehungsheimen. Diese waren Opfer der „Jugendämter“ und Täter der Verschickungsheime zugleich. „Manchmal endeten die Unfälle in den Kurheimen tödlich. Im LWL-Archivamt sind rund 20 Todesfälle von Kurkliniken altenkundig“ (S. 147). Es kamen auch zwei Kinder mangels Aufsicht auf den Transporten ums Leben.
Weiterhin wurden Beruhigungsmittel gegeben. Es fanden Medikamentenversuchen ohne Einwilligung und Kenntnis der Eltern statt. Ein hoher Beamter beanstandet nicht den Tod eines Kindes, sondern die teuere Medikamentenrechnung. Diese wird dann vom Heimarzt reduziert (S. 158). Auch im Buch von Gilhaus wird von sexuellem Missbrauch durch das Personal berichtet (S. 163f.).
Täterinnen und Tätersuche
Nach den damaligen Gesetzen durften die Kinder geschlagen werden. Auch in den Schulen Bayerns wurde die Prügelstrafe erst in den 1980er Jahren abgeschafft (S. 129). Für Eltern: „Seit dem Jahr 2000 ist das Prügeln der eigenen Kinder eine Straftat“ (S. 283).
Auf den Seiten 165 bis 192 wird von der schwierigen Suche nach den Tätern des sexuellen Missbrauchs an mindestens zwölf Kindern in einem Heim der Thuiner Franziskanerinnen berichtet. Die Sache ist schon verjährt.
Auf den Seiten 199-264 beschreibt Gilhaus mit Blick auf die „Schwarze Pädagogik“ einige Vorläufer und Geschichte der Kurheime für Kinder. Nach 1945 ging es dann weiter. Es wurden nur einige Nazi-Begriffe gestrichen. Viele Täter von vor 1945 waren auch Täter danach (S. 261ff.).
Rückkehr nach Hause
Für die meisten ist der Horror zu Ende: Lieblosigkeit, willkürliche Strafen, Zwangsessen, Toilettengänge auf Kommando, Gewalt. Die Kinder kamen verändert im Elternhaus an. Eine Fünfjährige konnte sich nicht mehr erinnern, wer die Eltern waren. „Vielen Verschickungskindern fehlt jemand, der genau nachfragt“ (S. 273).
Auch für die Darstellungen von Gilhaus gilt der Satz von Lorenz: „Wer von seinen Verschickungserlebnissen erzählt, klagt offen oder verdeckt immer auch ein wenig die eigenen Eltern an“ (Lorenz 2021, S. 87).
Wie repräsentativ sind die Erfahrungen?
Gilhaus erwähnt die Auswertung von 1.000 öffentlich zugänglichen Kommentaren. Danach hatten über 90 Prozent die „Kur“ als „negativ“ bewertet und 60 Prozent gaben an, noch an den Spätfolgen zu leiden (S. 278).
Auch noch heute gibt es Kuren für Kinder. Jährlich werden etwa 45.000 zur Reha geschickt. Bei Kindern unter zwölf Jahren darf eine erwachsene Begleitperson dabei sein (S. 286).
Aufarbeitung der Kinderkuren?
NRW und Baden-Württemberg sind bisher die einzigen Bundesländer, welche Vereine zur Aufarbeitung der Kinderkuren unterstützen (S. 294).
Zusammenfassung: Das Buch von Gilhaus gefällt mir vor allem, weil es durch die Anmerkungen viele nachprüfbare Fakten enthält und damit Opfern auf der Suche nach „ihren“ Heimen sowie dem Verbleib der Täter helfen kann.
Die drei Bücher von Röhl, Lorenz und Gilhaus
Diese Bücher sind gut lesbar, kommen zu ähnlichen Ergebnissen: sie ergänzen sich. Teilweise beschäftigen sie sich mit den gleichen NS-Tätern in den westdeutschen Heimen nach 1945. Sie hatten (vermutlich), unabhängig voneinander, diese Leute in den Akten gefunden sowie deren Karrieren vor und nach 1945 dokumentiert. Das ist ein großes Verdienst der drei Autorinnen, die alle von der Jounalistik und nicht der akademischen Pädagogik kommen.